Fremde im eigenen Land
Von Gisela Daunis
Wir waren Flüchtige aus Schlesien und lebten Ende der vierziger Jahre in einer kleinen Stadt des Bayerischen Waldes. Wir, das waren meine Mutter Lieselotte, meine Großmutter Klärchen, meine um eineinhalb Jahre jüngere Schwester Petra, und ich, Gisela. Meine Schwester war damals etwa sechseinhalb und ich acht Jahre alt. Wir hatten bei einem reichen Mühlen- und Sägewerksbesitzer Unterkunft gefunden, etwas außerhalb des Ortes, und wohnten unterm Dach des Gesindehauses, in zwei Zimmerchen, von denen nur eines, mit einem Holzofen, beheizt werden konnte.
Der eine Raum bot Platz für einen Tisch und vier Stühle, gegenüber eine Pritsche, die tagsüber als Sofa und nachts als Schlafstelle für die Großmutter diente, daneben ein schmales Regal aus Holzbrettern für Geschirr und Töpfe. Neben dem Tisch, in der Ecke, stand das Bulleröfchen, rund und gusseisern, auf dessen einziger Platte auch gekocht wurde. Im anderen Raum befand sich ein Schrank und drei eiserne Betten, die unser Großonkel aus einem Militärlazarett für uns organisiert hatte. Beide Räume hatten auf der einen Seite schräge Wände, von einem winzigen Fensterchen unterbrochen, das auf das Dach führte. Im Winter deckte sie der Schnee manchmal völlig zu. Wasser musste unten im Hof von einem Brunnen geholt werden. Zwischen den beiden Räumen gab es keine Tür, denn sie waren ja vorher einzelne Schlafstellen für Knechte oder Mägde gewesen. Wenn man aus den Kammern trat, befand man sich auf dem riesigen Dachboden mit allerlei Gerümpel und Wäscheleinen. Im Winter war es so kalt, dass man uns Kinder in Decken mummte, bevor wir in die Nachbarkammer zum Schlafen gebracht wurden. Weil man diesen Raum nicht heizen konnte, schliefen wir mit dicken Wollmützen.
 Wir Kinder merkten kaum, wie viel Mühe und Sorge es bereitete, den Lebensunterhalt zu bestreiten. Die Mutter half manchmal beim Bauern, bei der Ernte, oder sie hackte Holz, und bekam dafür etwas Milch, Mehl oder Eier. Die Großmutter nähte für fremde Leute. Nähen galt bei jenen Bauern nicht als Arbeit, weil man dabei sitzen konnte. Damit wurde die geringe Vergütung begründet, die mit Nahrungsmitteln entlohnt wurde, z.B. mit Gemüse oder Obst, wenn es sonst zu verfaulen drohte. Mutter und Großmutter sammelten auch Brennholz und Tannenzapfen im Wald, damit wir etwas zum Feuern hatten. Im Sommer pflückten wir eifrig Beeren und sammelten Pilze.
Wir Kinder merkten kaum, wie viel Mühe und Sorge es bereitete, den Lebensunterhalt zu bestreiten. Die Mutter half manchmal beim Bauern, bei der Ernte, oder sie hackte Holz, und bekam dafür etwas Milch, Mehl oder Eier. Die Großmutter nähte für fremde Leute. Nähen galt bei jenen Bauern nicht als Arbeit, weil man dabei sitzen konnte. Damit wurde die geringe Vergütung begründet, die mit Nahrungsmitteln entlohnt wurde, z.B. mit Gemüse oder Obst, wenn es sonst zu verfaulen drohte. Mutter und Großmutter sammelten auch Brennholz und Tannenzapfen im Wald, damit wir etwas zum Feuern hatten. Im Sommer pflückten wir eifrig Beeren und sammelten Pilze.
Gisela Daunis (rechts)
mit Mutter und Schwester
vor dem Haus aus ihrem Bericht
im Jahr 1948.
Foto: privat.
Weil wir Mangel an Nahrung hatten, bekam ich nach der Währungsumstellung (Juni 1948) Gelbsucht. Es war die Folge der besseren Nahrung, auf die mein Körper nicht eingestellt war. Die Kriegerwitwenrente unserer Mutter war so gering, dass wir die schlechte Zeit kaum überstanden hätten, wären da nicht hin und wieder die Pakete aus Schweden gewesen. Meine Mutter hatte vor dem Krieg dort ein Jahr bei einer befreundeten Familie verbracht. Diese Familie schickte uns Dosen mit Nahrungsmitteln und gut erhaltene Kleidung. Meine Großmutter trennte die Hosen, Röcke und Mtel auf, wendete sie und nähte daraus für uns alle Neues. Mein erstes gekauftes Kleid bekam ich erst mit 17 Jahren! Für uns Kinder war das Wichtigste an den Paketen eine Tüte Bonbons oder eine Tafel Schokolade. So etwas gab es ja sonst nie!
Trotz des Mangels an materiellen Dingen hatten wir eine glückliche Kindheit. Die Großmutter, unser geliebtes Klärchen, war immer für uns da, fröhlich und guter Dinge. Sie sang und erzählte uns Märchen, bastelte Spielzeug, zeichnete, oder machte Handarbeiten mit uns. War es kalt, bestaunten wir die Eisblumen am Fenster und lauschten Andersens Märchen von der Schneekönigin usw. Kam der Sommer, verbrachten wir ganze Tage im Wald, bauten aus Moos und Stöckchen zwischen großen Baumwurzeln Zwergenhäuser und -Städte und beobachteten Vögel, Käfer, Ameisen, und bisweilen sogar Hasen und Rehe. Währenddessen besorgte unsere Mutter alles, was „draußen“ war, d.h. Einkäufe, Erledigungen und Gänge zu den Ämtern und Schulen, und bald auch ehrenamtliche Aufgaben der evangelischen Diasporagemeinde und des VdK (Verband der Kriegerwitwen und –Waisen). Aber es gab auch Tage, an denen sie still auf der Pritsche in unserem ‚Wohnzimmer‘ lag, mit geschlossenen Augen. Großmutter sagte, sie habe starkes Kopfweh und wir sollten nicht laut sein. Meist unternahm sie dann etwas mit uns. Erst im Rückblick ahnten wir, dass unsere Mutter unter Depressionen litt, die sie aber nicht zeigen durfte. Sie hat ihre ganze Trauer um den geliebten Mann und ihre ganze Sehnsucht wortlos in sich hinein geschluckt.
 Als Flüchtlinge waren wir Außenseiter. Wir verstanden kaum den Dialekt der Wäldler. Die Einheimischen waren römische Katholiken, wir wenigen Flüchtlinge Protestanten. Dass wir doch zurückgehen sollten, wo wir herkämen, haben die Bauern öfters zu uns gesagt. Ich war sehr schüchtern. Wegen meiner Haarfarbe riefen die Jungen „Roter Fuchs!“ hinter mir her. In der Schule wurde mir bewusst, dass die einheimischen Kinder mehr hatten als ich: Malkreiden, Butterbrote, schönere Kleidung. Aber vor allem, die meisten hatten Väter! Ab da begann ich, unseren Vater zu vermissen.
Als Flüchtlinge waren wir Außenseiter. Wir verstanden kaum den Dialekt der Wäldler. Die Einheimischen waren römische Katholiken, wir wenigen Flüchtlinge Protestanten. Dass wir doch zurückgehen sollten, wo wir herkämen, haben die Bauern öfters zu uns gesagt. Ich war sehr schüchtern. Wegen meiner Haarfarbe riefen die Jungen „Roter Fuchs!“ hinter mir her. In der Schule wurde mir bewusst, dass die einheimischen Kinder mehr hatten als ich: Malkreiden, Butterbrote, schönere Kleidung. Aber vor allem, die meisten hatten Väter! Ab da begann ich, unseren Vater zu vermissen.
Petra und Gisela Daunis
im Jahr 1946.
Foto: privat
Ein Bild des Vaters, er wurde nur 30 Jahre alt!, stand auf Augenhöhe auf dem Regal. Und daneben befand sich die Aufnahme eines Bungalows mit einem Nebengebäude, umgeben von hohen Bäumen in einer parkähnlichen Landschaft, von einer Anhöhe aus fotografiert. „Das ist unser Haus in Soni, im Usambaragebirge in Afrika!“, erklärte die Mutter. Wir wussten, dass unser Vater als Soldat in Russland gefallen war. Dass er der liebste Vater der Welt war. Und dass er ein Haus für uns gebaut hatte, als wir noch gar nicht auf der Welt waren. „Wo ist Afrika? Wie sieht es dort aus?“ wollten wir wissen. Die Mutter zeigte uns ein Fotoalbum, in dem es noch mehr Bilder aus Afrika gab. Der Palmen bewachsene Strand von Tanga faszinierte uns Kinder am meisten. Aber wir freuten uns auch an den Kleinkind-Reihen, die Vater von mir geknipst hatte, und an den Bildern, die unsere Eltern als verliebtes Paar und unsere Wohnung in Schlesien zeigten. Es war gut, dass wir dieses Album hatten. Es war das einzige Erinnerungsstück, das unsere Mutter und Großmutter auf die Flucht hatten mitnehmen können, und das uns mit unserem früheren Leben verband.
In mir entwickelte sich ein ähnliches Bewusstsein wie das der im Märchen zur Magd verwunschenen Prinzessin, die nur allein um ihre wahre Herkunft weiß. Im Bayerischen Wald waren wir Habenichtse und gering geachtet, aber in Wirklichkeit waren wir etwas ganz Besonderes. Unser Vater war weit draußen in der Welt gewesen, in einem Land, das wunderschön war. Und dort stand ein Haus, das uns gehörte. „Wenn ich groß bin, werde ich dieses Haus und dieses Land sehen!“ nahm ich mir vor. Als ich etwas älter wurde, tauchten die Fragen nach dem Warum auf: „Warum ist unser Vater nach Afrika gegangen? Warum vorher seine Eltern? Was hatten Deutschland und Afrika miteinander zu tun? Was passierte in den Weltkriegen?“ So wurde früh in mir der Grund für meine Wissbegierde nach anderen Ländern, ihren Menschen und ihrer Geschichte, gelegt. Dieser Drang begleitete mich auch später. Ich notierte Erzählungen der Großeltern, sammelte Fotos und Schriftstücke entfernterer Verwandter, soweit ich konnte, und verschlang Bücher über ferne Länder. Der Wunsch, mehr über die Vergangenheit meiner Familie, über die Gründe und Umstände des Auswanderns zu erfahren, tauchte immer wieder auf, obwohl er zeitweise von den Turbulenzen des Studiums und des Familien- und Berufslebens verschüttet zu werden drohte. Erst im Alter konnte ich mir dann den Wunsch erfüllen, nach Tansania zu reisen und das Haus meines Vaters zu suchen.

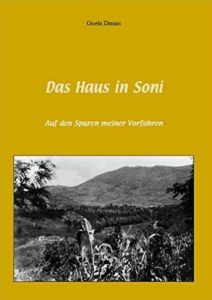 Haus – das ist ein Symbol für Verwurzelung, Heimat und Zugehörigkeit. Ein Haus, das man selbst entwirft und baut, ist geprägt von der Identität seines Erbauers. Das Haus meines Vaters in Soni war gedacht für seine Kinder und deren Kinder, sollte sich ihrem Werdegang anpassen und ihre Geschichte beherbergen. Auch wenn die Hoffnungen meines Vaters mit ihm jäh gestorben waren, wollte ich ihm doch diese späte Anerkennung und Würdigung zollen, sein Werk zu sehen.
Haus – das ist ein Symbol für Verwurzelung, Heimat und Zugehörigkeit. Ein Haus, das man selbst entwirft und baut, ist geprägt von der Identität seines Erbauers. Das Haus meines Vaters in Soni war gedacht für seine Kinder und deren Kinder, sollte sich ihrem Werdegang anpassen und ihre Geschichte beherbergen. Auch wenn die Hoffnungen meines Vaters mit ihm jäh gestorben waren, wollte ich ihm doch diese späte Anerkennung und Würdigung zollen, sein Werk zu sehen.
Gisela Daunis, geb. 1941 in Liegnitz, lebt heute in Asperg.
Die Lehrerin ist verheiratet, hat zwei Kinder
und vier Enkelkinder und ist als Malerin und Bildhauerin aktiv.
Sie stellt ihre Werke regelmäßig aus.
Der Text ist ein Auszug aus ihrem Buch „Das Haus in Soni“.
